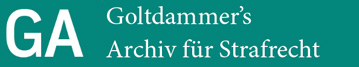Aktuelle Ausgabe 2/2026
Abhandlungen
Professor Dr. Paul Krell / Wiss. Mit. Jan-Christian Schröder, Hamburg
Betrug bei Abschluss oder Durchführung eines Maklervertrags
GenStA Professor Dr. Ralf Peter Anders, Schleswig/Hamburg
Befangenheit von Staatsanwälten in der Hauptverhandlung
Zugleich Anmerkung zu BGH, Beschl. v. 18.1.2024 - 5 StR 473/23
Dr. Samuel Strauß, Konstanz
Das tatbestandsausschließende Einverständnis in menschenverursachten Zwangslagen
Zusammenhänge mit § 240 StGB
Schrifttum
Professor em. Dr. Christoph Sowada, Greifswald
Jil Schneider, Deaktivierung von Implantaten am Lebensende
Professor em. Dr. Christoph Sowada, Greifswald
Claudia Stühler, Sterbehilfe bei Cyborgs
Professor Dr. Georg Steinberg, Potsdam
Pauline Viktoria Holtmann/Moritz Vormbaum, Rechtsstaatliche Reste in der NS-Justiz?
_____________________________
Abhandlungen
Professor Dr. Paul Krell / Wiss. Mit. Jan-Christian Schröder, Hamburg
Betrug bei Abschluss oder Durchführung eines Maklervertrags
Besondere Vertragstypen führen häufig zu besonderen Problemen bei der Frage, ob Täuschungen bei Abschluss oder Durchführung solcher Verträge als Betrug (§ 263 StGB) strafbar sein können. Ein Beispiel dafür ist der Maklervertrag (vgl. §§ 652 ff. BGB). Die Leitentscheidung dazu (BGH v. 21.12.1982 - 1 StR 662/82, BGHSt 31, 178) ist über vierzig Jahre alt: Der Angeklagte wollte eine Immobilie erwerben und schloss zu diesem Zweck einen Maklervertrag, wobei er seine Zahlungsunfähigkeit verschwieg. Den Leitsätzen der Entscheidung zufolge liegt erstens ein vollendeter Betrug erst vor, wenn das vom Makler nachgewiesene oder vermittelte Geschäft zustande gekommen ist. Zweitens ist ein Versuch erst gegeben, wenn der Auftraggeber Handlungen vornimmt, die nach seiner Vorstellung unmittelbar zum Abschluss des Geschäfts führen. Beide Aspekte sind problematisch und in den wenigen Stellungnahmen zu der Entscheidung auch problematisiert worden. Täuschungen bei Abschluss oder Durchführung des Maklervertrags werfen aber noch weitere Fragen auf, die bisher kaum erörtert wurden. Um sich der Problematik anzunähern, werden zunächst die Grundzüge des Maklervertrags erläutert (dazu II.). Anschließend gilt es, verschiedene Anknüpfungspunkte für eine Betrugsstrafbarkeit herauszuarbeiten, und zwar sowohl in zeitlicher als auch in sachlicher Hinsicht (dazu III.). Näher in den Blick zu nehmen sind der Abschluss des Maklervertrags (dazu IV.), der Moment, in dem die Maklerin oder der Makler Aufwendungen tätigt (dazu V.), und schließlich der Abschluss des Hauptvertrags, wodurch der Vergütungsanspruch entsteht (dazu VI.). Der Beitrag nimmt nur die Konstellation in den Blick, dass eine Kaufinteressentin oder ein Kaufinteressent einen Maklervertrag abschließt, um ein Grundstück zu erwerben. Solche Sachverhalte sind es auch, die bisher die Rechtsprechung beschäftigt haben.
Sie haben Goltdammer"s Archiv abonniert? Dieser Link führt Sie direkt zum Beitrag in der Datenbank.
Sie haben noch kein Abonnement? Hier können Sie ein Abo bestellen.
GenStA Professor Dr. Ralf Peter Anders, Schleswig/Hamburg
Befangenheit von Staatsanwälten in der Hauptverhandlung
Zugleich Anmerkung zu BGH, Beschl. v. 18.1.2024 - 5 StR 473/23
Neuere Entscheidungen des BGH schärfen für Fälle der Befangenheit des Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft in der Hauptverhandlung den Weg über die Verfahrensrüge des Angeklagten wegen Verletzung des Rechts auf ein faires und justizförmiges Verfahren aus. Im Gegensatz zur Mitwirkung eines ausgeschlossenen Richters oder eines mit Blick auf diesen fehlerhaft abschlägig beschiedenen Ablehnungsgesuchs soll der Verfahrensfehler der Mitwirkung eines befangenen Staatsanwalts jedoch nur einen relativen Revisionsgrund nach § 337 StPO begründen können. Zudem verlangt der BGH zur Konkretisierung der abstrakten verfassungs- und konventionsrechtlichen Maximen einen im Vergleich zum Richter abgesenkten Beurteilungsmaßstab, nach dem die Gründe für die Besorgnis der Befangenheit des Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft ähnlich schwerwiegen sollen wie die Ausschlusstatbestände der §§ 22, 23 StPO. In diesem Beitrag soll die Entwicklung dieser Rechtsprechung dargestellt und ihre Begründung kritisch hinterfragt werden. Verf. plädiert gegen eine relationale Gewichtung des Verstoßes anhand des (richterlichen) Maßstabs der §§ 22, 23 StPO und für die Etablierung einer eigenen, mit Blick auf Staatsanwälte fallgruppenspezifischen Obersatzbildung zur Konkretisierung der Schwere der verfassungs- und konventionsrechtlich hergeleiteten Rechtsverletzung.
Sie haben Goltdammer"s Archiv abonniert? Dieser Link führt Sie direkt zum Beitrag in der Datenbank.
Sie haben noch kein Abonnement? Hier können Sie ein Abo bestellen.
Dr. Samuel Strauß, Konstanz
Das tatbestandsausschließende Einverständnis in menschenverursachten Zwangslagen
Zusammenhänge mit § 240 StGB
Das tatbestandsausschließende Einverständnis ist eine komplexe Rechtsfigur. Nach dem zentralen Grundanliegen soll die Zustimmung des Berechtigten unter bestimmten Voraussetzungen nicht erst rechtfertigend wirken, sondern bereits auf der vorgelagerten Ebene des objektiven Tatbestands zu berücksichtigen sein. Es liegt auf der Hand, dass nicht jedes nur tatsächlich vorliegende Einverständnis das strafrechtliche Unrecht auszuschließen vermag. Vielmehr muss dieses - jedenfalls grundsätzlich - noch Ausfluss einer freien Entscheidung sein. Andernfalls kann von einer echten Zustimmung keine Rede sein. Vor diesem Hintergrund drängen sich Zweifel an der Wirksamkeit auf, wenn das Einverständnis unter dem Eindruck einer gezielt herbeigeführten Zwangslage erfolgt.
Sie haben Goltdammer"s Archiv abonniert? Dieser Link führt Sie direkt zum Beitrag in der Datenbank.
Sie haben noch kein Abonnement? Hier können Sie ein Abo bestellen.